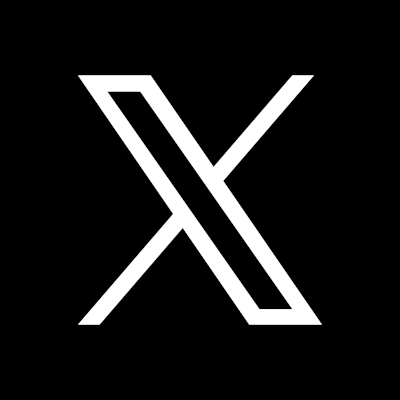News
Der Fachbereich Rechtswissenschaft
der Johann Wolfgang Goethe-Universität
trauert um
Prof. Dr. Dr. h.c. Gerhard Dilcher
* 14. Februar 1932 † 1. Juli 2024
Gerhard Dilcher war Professor für Deutsche Rechtsgeschichte, Kirchenrecht und Zivilrecht (1972 bis 1998) am Fachbereich Rechtswissenschaft. Er hat sich besonders große Verdienste auf den Feldern der mittelalterlichen Rechtsgeschichte und der Wissenschaftsgeschichte erworben. Seine besondere Leidenschaft galt Italien und der Vorbildwirkung der italienischen Stadtrepubliken für die europäische Geschichte. Vielen Jüngeren, Doktorandinnen und Doktoranden wie Habilitanden, hat er durch engagierte Förderung die wissenschaftliche Laufbahn eröffnet. Als Lehrer war er ein großes Vorbild.
Wir haben einen bedeutenden Wissenschaftler und zugewandten Kollegen verloren. Sein Andenken werden wir in Ehren halten.
Prof. Dr. Stefan Kadelbach
Dekan des Fachbereichs Rechtswissenschaft
der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
Wissenschaftliche Tagung
„Übergewichtsprävention oder Abnehmspritze? Ernährung, Verantwortung und Gesundheit“
am 20. September 2024 von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Raum 1.801 im Casino-Gebäude auf dem Campus Westend
Die Ernährung hat (neben der Bewegung) großen Einfluss auf die Entstehung von Übergewicht und Adipositas und damit auch auf die Gesundheit. Studien zufolge belaufen sich die durch eine zu zucker-, salz- und fettreiche Ernährung entstehenden Kosten des Gesundheitssystems auf ca. 17 Mrd. Euro pro Jahr. Dies wirft die Frage auf, inwieweit der Staat durch präventive Maßnahmen bereits auf die Vermeidung von Übergewicht hinwirken muss, inwiefern einzelne Personen allein für ihre Ernährung und Gesundheit verantwortlich sind und in welchen Fällen Ansprüche auf solidarisch finanzierte Gesundheitsleistungen bestehen. Brauchen wir eine Zuckersteuer oder ein Verbot von Lebensmittelwerbung, die sich an Kinder richtet? Unter welchen Voraussetzungen sollten die Krankenkassen Leistungen wie Magenverkleinerungen bezahlen? Die Entwicklung der sogenannten Abnehmspritze, die von einigen als „Gamechanger“ bezeichnet wird, wird diese Fragen in neuer Weise stellen, bringt aber gleichzeitig einige klärungsbedürftige Aspekte wie etwa Verteilungsfragen bei Knappheit mit sich.
Die Tagung wird in Präsenz stattfinden. Ein Tagungsbeitrag wird nicht erhoben. Bitte melden Sie sich bis 11.9.2024 an über ineges@jur.uni-frankfurt.de. Nähere Informationen sowie das Tagungsprogramm können Sie dem Flyer entnehmen.
Am Verleihung fand am Donnerstag, dem 4. Juli 2024, im Rahmen einer Feierstunde auf dem Campus Westend der Goethe-Universität statt.
Einen Bericht dazu können Sie hier nachlesen.
- Aktuelles und Presse
- Pressemitteilungen
- Öffentliche Veranstaltungen
- Uni-Publikationen
- Aktuelles Jahrbuch
- UniReport
- Forschung Frankfurt
- Aktuelle Stellenangebote
- Frankfurter Kinder-Uni
- Internationales
- Outgoings
- Erasmus / LLP
- Goethe Welcome Centre (GWC)
- Refugees / Geflüchtete
- Erasmus +
- Sprachenzentrum oder Fremdsprachen
- Goethe Research Academy for Early Career Researchers
- Forschung
- Research Support
- Forschungsprojekte, Kooperationen, Infrastruktur
- Profilbereich Molecular & Translational Medicine
- Profilbereich Structure & Dynamics of Life
- Profilbereich Space, Time & Matter
- Profilbereich Sustainability & Biodiversity
- Profilbereich Orders & Transformations
- Profilbereich Universality & Diversity